
Wie die Spaltung zwischen ELF und EFA den professionellen American Football in Europa neu gestalten könnte
Veröffentlicht von Coach Rosenbaum, vom Englischen ins Deutsche übersetzt und neu verfasst: HansEwald
Fünf Jahre. So lange gibt es die European League of Football jetzt – und in dieser Zeit ist mehr passiert, als manch anderer Sportliga in einem Jahrzehnt zustande bringt. Aus einem ambitionierten Projekt mit ein paar wackligen Helmaufklebern wurde ein ernstzunehmendes Produkt, das Stadien füllt, TV-Zeit bekommt und sogar die Aufmerksamkeit von Fans in Übersee geweckt hat. Doch wer im Football glaubt, dass der Touchdown das Ende der Reise ist, hat das Playbook nicht verstanden. Nach dem Jubel kommt die nächste Challenge. Und genau da steht die ELF jetzt: am Scheideweg zwischen weiterem Wachstum und einem internen Gerangel, das zur größten Prüfung ihrer noch jungen Geschichte werden könnte.
Vom Power-Couple zur Baustelle
Als Patrick Esume und Zeljko Karajica vor fünf Jahren die ELF ins Leben riefen, wirkte das wie der Traumstart einer Football-Romcom: Der eine das Gesicht und die Stimme, ein ehemaliger Coach mit Entertainer-Gen, der den Sport in Europa wie kein Zweiter verkaufen konnte. Der andere ein erfahrener Strippenzieher im Mediengeschäft, der wusste, wie man ein Produkt großflächig platziert. Zusammen wollten sie das schaffen, was der NFL Europe nie gelang – nicht nur glänzende Gamedays, sondern echte Nachhaltigkeit.
Und zunächst lief das Drehbuch perfekt: mehr Teams, mehr Märkte, mehr Fans. Die Liga wuchs, als hätte jemand Madden auf „Franchise Mode“ gestellt und die Simulation durchlaufen lassen. Doch im fünften Jahr kommt der Plot-Twist: Spannungen hinter den Kulissen. Esume zieht sich aus dem Alltagsgeschäft zurück und konzentriert sich auf seine Medienprojekte mit Björn Werner. Karajica tritt ab, offiziell wegen „unterschiedlicher Auffassungen“, inoffiziell, weil Franchise-Eigner immer lauter die Frage stellten, wie eigentlich die Finanzen und das Tagesgeschäft geführt werden.
Das Resultat: Der Vorstand übernimmt, neue Köpfe für Marketing und Organisation sollen das Ruder halten. Aber schon im Sommer 2025 passiert das, wovor jeder Commissioner Albträume hat: elf Franchises – darunter Schwergewichte wie die Vienna Vikings und Frankfurt Galaxy – schließen sich zur European Football Alliance (EFA) zusammen. Auf einmal gibt es nicht nur einen Spielplan, sondern auch einen Plan B.
Das Problem: Football lebt von klaren Strukturen. Einer ruft den Spielzug rein, die anderen führen aus. Wenn aber elf Teams eigene Playbooks schreiben, droht Chaos. Genau diese Frage steht jetzt im Raum: Gelingt es, die Differenzen am runden Tisch zu lösen? Oder bekommt Europa demnächst zwei Ligen, die auf denselben Märkten um dieselben Fans konkurrieren?
Der Aufstieg – Feuer und Flamme
Wenn man das Wachstum der ELF in einer Grafik darstellen würde, sähe die Kurve aus wie ein Go-Route von Tyreek Hill: steil nach oben, ohne Rücksicht auf Verluste. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass eine Liga, die 2021 noch mit fragilen Helmen und halbleeren Tribünen startete, nur ein paar Jahre später Stadien füllen und TV-Quoten jagen würde, die in manchen Märkten fast schon „Big Four“-Feeling erzeugten.
Allen voran: Rhein Fire. Die Franchise aus Düsseldorf wurde nicht nur zum sportlichen Maßstab, sondern auch zum Publikumsmagneten. Zwei Championships in Serie, Fanmassen in lila und orange, die mit jedem Touchdown noch lauter wurden – Rhein Fire war mehr als nur ein Team. Sie wurden zum Symbol für das, was die Liga sein wollte: professionell, spektakulär und verdammt laut.
Parallel dazu holte die ELF nicht nur Spieler, sondern auch Coaches mit NFL-Referenzen nach Europa. Plötzlich standen an der Sideline Männer, die schon Playbooks in Foxborough oder Dallas durchgeackert hatten. Dazu kamen Sponsorenverträge, die über reines Logo-Schalten hinausgingen, und Expansion in neue Städte, die zeigten: Hier entsteht etwas, das bleiben könnte.
Das Muster war klar: Die ELF schien nicht nur ein Event für Hardcore-Football-Fans zu sein, sondern ein ernstzunehmendes Business. In mehreren Ländern formierten sich Geschäftsmodelle, die nachhaltiger wirkten als alles, was der Sport hierzulande je gesehen hatte.
Die Frage war nur: Konnte dieses Tempo auf Dauer gutgehen?
Prime Time in Europa
Während andere europäische Ligen noch mit YouTube-Streams und wackeligen Kommentatorspuren hantierten, zielte die ELF von Anfang an auf die große Bühne. Kein „Wir probieren’s mal digital“, sondern klassisch: Fernseher an, Bier kaltstellen, Football im Free-TV. Und siehe da: Die Quoten waren beeindruckend. Besonders die heiß begehrte Zielgruppe der 18- bis 49-jährigen Männer schaltete in Deutschland regelmäßig ein – ein Ritterschlag in einer Branche, in der genau diese Zahl über Sponsorenverträge entscheidet.
Doch damit hörte es nicht auf. Die Liga schaffte den Sprung über die Grenzen hinaus und sicherte sich internationale Partnerschaften mit Plattformen wie DAZN und FUBO. Damit gelang etwas, das europäische Football-Organisationen zuvor kaum hinbekommen hatten: echte Reichweite. Nicht mehr nur ein Livestream für Hardcore-Fans, sondern eine Präsentation, die in puncto Professionalität und Sichtbarkeit mit großen Profiligen mithalten konnte.
Für eine junge Liga war das ein Gamechanger. Denn während die NFL in Europa oft wie ein entfernter, unerreichbarer Riese wirkte, zeigte die ELF: Wir können unseren Sport nicht nur spielen, wir können ihn auch so inszenieren, dass er neben Fußball, Basketball oder Handball nicht wie der kleine Cousin aussieht, der mit zu großen Schulterpads herumläuft.
Geld regiert das Spiel – und das Publikum schaut zu
Als David Gandler zehn Millionen Dollar in die ELF investierte, war das mehr als nur ein Scheck auf dem Tisch – es war ein Ritterschlag für das Geschäftsmodell der Liga. Ein klares Signal: Hier glauben Profis an das Produkt, und zwar nicht nur, weil die Touchdowns spektakulär aussehen, sondern weil man wirtschaftlich etwas Vernünftiges daraus machen kann. Besonders spannend: Gandler sah in der Liga ein Sprungbrett für den Londoner Markt und ein Vehikel, um die internationale Strahlkraft des europäischen Footballs zu erhöhen.
Kapital ist das Sauerstoffzelt jeder aufstrebenden Liga. Ohne kontinuierliche Investitionen verblassen selbst die größten Erfolge. Dass die ELF das Vertrauen eines ernstzunehmenden Investors gewinnen konnte, sprach Bände über die Glaubwürdigkeit ihres Modells – ähnlich wie bei anderen aufstrebenden Ligen in Sportarten von Basketball bis Eishockey.
Doch Kapital bringt immer auch Brisanz mit sich. Die Geschichte lehrt: Ein Rückzug der Investoren kann eine Liga binnen Monaten destabilisieren – man erinnere sich nur an die Alliance of American Football 2019. Auch aktuelle Beispiele aus anderen Profisport-Startups zeigen, wie sensibel das Gleichgewicht zwischen Wachstum, operativer Stabilität und Investorenerwartungen ist.
Die zentrale Frage für die ELF lautet nun: Können die laufenden Umstrukturierungen die Sorgen der Franchise-Eigner zerstreuen, das Vertrauen der Investoren aufrechterhalten und gleichzeitig die Liga auf Kurs halten? Denn Wachstum und Stabilität sind im Profisport wie zwei Tackles gleichzeitig – verpasst man eines, stürzt man.
Die Allianz der Neinsager – EFA tritt auf den Plan
Wenn man dachte, die ELF sei bisher nur von außen herausgefordert worden, brachte der Sommer 2025 eine Lektion in Sachen interne Dynamik: Aus konkreten operativen Bedenken formierte sich die European Football Alliance (EFA). Anders als oft behauptet, ging es hier nicht um generelle Unzufriedenheit mit dem „Big Picture“, sondern um handfeste Kritik an den Strukturen: neun Teams, darunter Schwergewichte wie die Vienna Vikings und Frankfurt Galaxy, meldeten sich zu Wort und bezeichneten Teile des Ligamanagements als „unprofessionell“.
Die Franchises machten ernst. Über Plattformen wie American Football International verkündeten sie öffentlich ihre Position und organisierten systematisch Konferenzen in Frankfurt, um den Kurs ihrer Allianz festzulegen. Auf der Agenda standen ambitionierte Ziele: Umsatzbeteiligungsmodelle nach NFL-Vorbild, engere Koordination zwischen Liga und Franchise, und – nicht zu unterschätzen – der Aufbau von Grassroots-Programmen in allen europäischen Märkten.
Was hier entsteht, ist kein kindisches Gezänk, sondern strategisches Denken auf hohem Niveau. Die EFA reflektiert das Bewusstsein, dass Profi-Football in Europa nur dann langfristig funktioniert, wenn die Spielpläne der Liga nicht nur auf dem Feld, sondern auch hinter den Kulissen präzise getaktet sind. Für die ELF ist dies ein Weckruf: Wachstum und Struktur müssen Hand in Hand gehen – sonst könnten selbst die größten Touchdowns nichts daran ändern, dass die Basis bröckelt.
Die EFA hat ein Statement veröffentlicht. Dort richtet sie deutliche Worte in Richtung der ELF. pic.twitter.com/VmluxfiBhw
— Sebastian Mühlenhof (@Seppmaster56) July 15, 2025
Geld, Macht und die Rechenmaschine hinter den Kulissen
Hinter jedem spektakulären Touchdown steckt eine simple Wahrheit: Ohne Geld läuft nichts. Und genau hier liegt der Kern der aktuellen Spannungen zwischen ELF und EFA. Es geht nicht um Spielzüge, Cheerleader oder Trikotfarben – es geht um die Verteilung der Einnahmen und die Frage, wer am Ende des Tages die Kosten trägt.
Die EFA-Franchises kritisieren die derzeitige Praxis der Liga: Während die Teams Ticketverkäufe, lokale Sponsoren und Merchandising stemmen, behält die Ligaleitung einen großen Teil der Erlöse aus den Erfolgen der Franchises ein. Klingt theoretisch fair, doch in der Praxis kann das schnell zur Gratwanderung werden. Wenn Wettbewerbsnachteile dazu führen, dass Spiele vorhersehbar werden, sinken die Zuschauerzahlen. Wer weniger Fans ins Stadion lockt, zahlt automatisch drauf: höhere Marketingkosten, weniger Sponsoreninteresse – eine finanzielle Spirale nach unten.
Die Position der EFA ist eindeutig: Erfolgreiche Teams sollten nicht die finanziellen Löcher schwächerer Teams stopfen, ohne dass eine gerechte Umsatzbeteiligung vereinbart wird. Es geht um Fairness, Transparenz und die langfristige Überlebensfähigkeit aller Franchises – ohne solche Maßnahmen droht das, was man im Sportbusiness am liebsten vermeidet: dass aus der Liga ein aufgeblähter Wettbewerb mit Pleitestimmung wird.
Die Botschaft ist klar: Geld ist nicht alles, aber ohne ein funktionierendes Finanzsystem verliert selbst der spektakulärste Football seinen Wert.
Fundament statt Blitzlicht – die Basisarbeit der EFA
Was die EFA-Franchises auszeichnet, ist nicht nur ihr Name auf dem Trikot oder die Anzahl der gewonnenen Spiele. Es sind Organisationen mit Substanz: operative Exzellenz, echte Community-Arbeit und eine nachgewiesene Wettbewerbsfähigkeit. Nehmen wir die Vienna Vikings: Ein Reserveteam, Jugendförderprogramme, klar definierte Talentpfade – hier wird American Football nicht nur gespielt, hier wird er gelebt und strategisch aufgebaut.
Auch die neueren Franchises haben ihre Lektion gelernt. Durch Partnerschaften mit nationalen Programmen schaffen sie Strukturen, die den Sport von unten nach oben wachsen lassen. Beides erfordert Geduld, Kapital und langfristige Visionen – keine kurzfristigen Umsatzspritzen, kein Schnellschuss-Management.
Die Botschaft der EFA ist klar: Nachhaltiger Erfolg in Europa entsteht nicht durch den Import von Spielern aus Übersee, sondern durch starke Systeme an der Basis. Wer die Liga langfristig stabil halten will, muss investieren – in Trainingsplätze, Nachwuchsprogramme, Coaching und vor allem in die Communities, in denen der Sport noch immer ein Nischenprodukt ist.
Kurz gesagt: Die EFA spielt nicht nur die Gegenwart, sie baut die Zukunft. Und wer in einem Markt mit vergleichsweise kurzer Football-Geschichte Erfolg haben will, weiß: Fundament schlägt Blitzlicht.
Chancen, Stolpersteine und die Gratwanderung der Liga
Die ELF hat nach wie vor starke Karten auf der Hand: ein etabliertes Branding, tragfähige Medienpartnerschaften und das Vertrauen potenzieller Investoren. Gleichzeitig kämpfen einige Franchises mit operativen Problemen, die unabhängig von der Liga gelöst werden müssen – eingeschränktes Social-Media-Engagement, Reisebeschränkungen für Spieler oder schlicht reduzierte Kapazitäten. Das zeigt: Nicht alle Herausforderungen liegen in der Governance der Liga; manches ist strukturell und betriebsbedingt.
Die Liga könnte ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Kooperationen mit erfahrenen Programmen wie den Danube Dragons, Paris Flash oder London Warriors stärken. Diese Organisationen bringen Know-how in zentralen europäischen Märkten mit und könnten helfen, den Übergang vom Elite-Amateur- zum Profibetrieb zu gestalten – vorausgesetzt, Umsatzbeteiligung, Geschäftsentwicklung und strategische Planung werden ernst genommen.
Für die EFA gilt ein ähnliches Prinzip, nur mit eigenen Stolpersteinen: Medienvertrieb, operative Koordination und fehlende zentrale Infrastruktur sind echte Herausforderungen. Die anfängliche Berichterstattung über Plattformen wie American Football International reicht vielleicht fürs erste, doch nachhaltiges Wachstum erfordert tiefere, lokalisierte Medienstrategien. Regional erfolgreiche Profiligen zeigen, dass man besser langsam, aber solide expandiert, als auf schnelle Reichweite zu setzen, ohne das Fundament zu sichern.
Die Mitgliedsverbände der EFA bringen Erfahrung aus Amateurligen mit, die für den Aufbau professioneller Strukturen unabdingbar ist. Es geht um mehr als Touchdowns auf dem Feld: Es geht darum, den Sport auf dem Kontinent nachhaltig zu verankern. Und genau hier entscheidet sich, ob die ELF die Balance zwischen professionellem Wachstum und operativer Stabilität halten kann – oder ob der europäische Football eine neue Liga braucht, die von Grund auf anders denkt.
Spielerentwicklung, Nationalligen und das Erbe der NFL Europe
Kein professioneller Sport existiert isoliert – und das gilt besonders für American Football in Europa. Sowohl ELF als auch EFA müssen die Spielerentwicklung vorantreiben, ohne dabei die nationalen Ligensysteme zu untergraben, die seit Jahrzehnten die Basis des Sports bilden. Die Lektionen aus dem Ende der NFL Europe sind klar: Wenn Profi-Ligen die Stabilität der nationalen Systeme gefährden, verlieren Sponsoren schnell das Vertrauen – und mit ihnen die finanzielle Grundlage für Wachstum.
Die Erholung nach der NFL Europe hat Jahre gedauert, insbesondere in Deutschland, wo sich die nationalen Ligen nur langsam wieder stabilisierten. Heute sind sie stark, gut organisiert und bilden das Rückgrat des europäischen Footballs. Dieses Fundament darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Zwei konkurrierende Profi-Strukturen könnten sonst zu einem unhaltbaren Talentabfluss führen – weg von den Nachwuchsprogrammen, weg von den Nationalmannschaften, weg von der langfristigen Entwicklung.
Die Botschaft ist eindeutig: Erfolg auf Profi-Niveau und nachhaltige Entwicklung nationaler Programme müssen Hand in Hand gehen. Beide Organisationen sind gefordert, die Gesamtentwicklung des europäischen Footballs über kurzfristige Konkurrenzkämpfe zu stellen. Wer begrenzte Ressourcen egoistisch verteilt, riskiert nicht nur die Zukunft einzelner Franchises, sondern die Lebensfähigkeit des Sports auf dem gesamten Kontinent.

Kompromiss als Schlüssel – die Chance der Liga
Das konstruktivste Szenario für den europäischen Football ist klar: Eine Einigung zwischen ELF und EFA, die Fragen der Umsatzaufteilung, der operativen Koordination und der Governance löst. Das erfordert echte Kompromisse – keine Lippenbekenntnisse, sondern strukturelle Änderungen, die sowohl die Interessen der Franchises berücksichtigen als auch die Kohärenz der Liga wahren.
Die Geschichte des Sports zeigt: Ligen erreichen ihre stärksten Phasen oft genau nach solchen internen Prüfungen. Konflikte zwingen dazu, Geschäftsmodelle zu verbessern, Governance-Strukturen zu überdenken und operative Prozesse zu professionalisieren. Wer diese Chance nutzt, kann nicht nur die aktuelle Krise überwinden, sondern ein Fundament für nachhaltigen Erfolg legen.
Für die ELF und den europäischen Football bedeutet das: Touchdowns allein reichen nicht. Es geht darum, wie man zusammenarbeitet, Strukturen festigt und den Sport auf dem Kontinent dauerhaft stabilisiert. Eine Liga, die diese Balance findet, könnte nicht nur die nächste Meisterschaft ausspielen – sie könnte Geschichte schreiben.
Zwei Ligen, ein Kontinent – das Risiko der Konkurrenz
Es gibt jedoch auch die weniger harmonische Variante: ELF und EFA agieren unabhängig und schaffen konkurrierende Profi-Strukturen in denselben europäischen Märkten. Ein solches Szenario könnte spannend klingen – zwei Ligen, doppelte Action, mehr Touchdowns für die Fans – in der Realität droht jedoch ein heikler Balanceakt.
Der Erfolg würde davon abhängen, dass beide Organisationen ausreichende Medienpartnerschaften sichern, Sponsoren gewinnen und die operative Koordination meistern. Selbst kleine Fehltritte könnten teuer werden: ein Talent, das die falsche Liga wählt, ein Sponsor, der sich für das falsche Team entscheidet, oder ein Spiel, das medial untergeht. Die Gefahr eines destruktiven Wettbewerbs ist hoch. Wer zu aggressiv um begrenzte Ressourcen wie Spieler, Sponsoren und Aufmerksamkeit kämpft, riskiert nicht nur kurzfristige Verluste, sondern langfristig das Fundament des europäischen Footballs.
Kurz gesagt: Zwei konkurrierende Strukturen könnten spektakulär aussehen, aber sie sind ein Drahtseilakt über einem Markt, der Geduld, Koordination und strategisches Denken verlangt. Wer hier stürzt, nimmt mehr mit als nur ein paar verlorene Spiele.
Konzentration statt Zersplitterung – Lehren aus der Geschichte
Europäische Märkte haben wahrscheinlich mehr Kapazität für eine starke Profiliga als für mehrere konkurrierende Strukturen. Medienpartnerschaften, Sponsorenengagement und Fanaufmerksamkeit sind begrenzte Ressourcen – besser gebündelt als zersplittert.
Die Geschichte des American Football liefert zahlreiche Beispiele: AFL und NFL fusionierten nach Jahren des Wettbewerbs, und jüngere Beispiele wie XFL und USFL zeigen, dass anfängliche Konkurrenz Innovationen und Qualitätssteigerungen fördern kann, bevor eine nachhaltige Struktur entsteht. Europa könnte von derselben Dynamik profitieren, wenn beide Organisationen die langfristige Entwicklung des Sports über kurzfristige territoriale Kontrolle stellen.
Die aktuelle Krise ist also mehr Chance als Katastrophe. Das Engagement aller Beteiligten zeigt, wie sehr Investitionen, Leidenschaft und Vision bereits in den europäischen Football geflossen sind. Nun gilt es, dass die ELF-Führung konkrete Änderungen liefert – keine Versprechungen – während die EFA-Franchises ihre berechtigten Bedenken mit realistischen Alternativen abwägen, die dem gesamten Sport zugutekommen. Konstruktive Verhandlungen könnten nicht nur die Krise lösen, sondern den europäischen Football auf ein neues Level heben.
Chance oder Umbruch – die Weichen für den europäischen Football
In nur fünf Jahren hat der europäische professionelle American Football durch die ELF ein bemerkenswertes Wachstum hingelegt. Doch nun stehen fundamentale Fragen im Raum: Kann dieses Fundament durch verbesserte Strukturen und Praktiken weiteres Wachstum tragen?
Die Klärung der Spannungen zwischen ELF und EFA wird die Entwicklung des Sports in Europa in den kommenden Jahren entscheidend prägen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Sport sein Potenzial ausschöpfen kann oder ob nach organisatorischen Umbrüchen ein Neuanfang nötig wird.
Europa verdient Strukturen, die den Spielern, Trainern und Talenten gerecht werden – und den Fans, die ihre Gemeinden durch diesen außergewöhnlichen Sport verbinden. Die aktuelle Krise ist nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance: die Chance, eine stabile, nachhaltige Grundlage für den Erfolg des europäischen Footballs zu schaffen. Wer diese Chance nutzt, könnte die Liga nicht nur retten, sondern Geschichte schreiben.
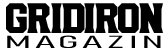











You must be logged in to post a comment Login