
Die EFA ist gespalten, noch vor dem ersten Snap
Lange Zeit wurde die Idee einer vollwertigen American-Football-Liga in Europa als ambitionierter, aber unrealistischer Traum angesehen. NFL Europe versuchte es. Es gab Interesse, es gab Talent – einige spätere NFL-Starter entstanden dort. Aber am Ende scheiterte das Projekt an fehlender wirtschaftlicher Tragfähigkeit und begrenzter Fanbindung.
Heute sieht die Situation anders aus. Und erstmals glauben Liga-Verantwortliche, Investoren und Marktstrategen, dass eine professionelle Football-Liga in Europa nicht nur überleben, sondern bestehen könnte.
Ein Kontinent wird footballverrückt
Was vor vielen Jahren wie ein Trend wirkte, ist inzwischen ein fester Bestandteil der europäischen Sportkultur geworden. Die NFL International Games in London, München, Berlin und Frankfurt? Innerhalb von Minuten ausverkauft.
Fans reisen hunderte Kilometer, nur um am Tailgate teilzunehmen. Trikots, Flaggen, Helme, Fanclubs — überall sichtbar. Ganze Bars öffnen nachts, um Primetime-Spiele zu zeigen. Doch eine eigene europäische Football Liga schafft es nicht, sich zu etablieren. Die NFL hatte es damals mit NFL Europe versucht und hatte Millionen US-Dollar an Verlusten eingefahren, so dass sie am Ende eingestellt wurde. Nur einige Ballungsgebiete, wie Rhein Fire und Frankfurt Galaxy hatten eine erfolgreiche Bilanz. Doch das hatte nicht gereicht, um eine Liga am Laufen zu halten.
Dasselbe Schicksal musste nun die ELF erfahren.
Die European League of Football (ELF) ist zwar noch nicht offiziell „gescheitert“ – sie existiert noch.
Aber: Sie kämpft mit massiven strukturellen und finanziellen Problemen, die in Teilen wie ein kontrolliertes Auseinanderfallen wirken. Ebenso wie damals die NFL-Europe. Einige Teams haben aufgegeben, Standorte wechselten, und das Vertrauen der Fans wurde mehrfach beschädigt.
Die Hauptgründe, warum die ELF ins Straucheln geraten ist
Ein zentraler Faktor war das zu ambitionierte finanzielle Modell. Die European League of Football trat von Beginn an mit dem Anspruch auf, wie eine echte Profiliga wahrgenommen zu werden. Dazu gehörten US-Importspieler, voll bezahlte Coaching-Staffs, Spiele in großen Stadien, professionelle TV-Produktionen und ein Marketingauftritt, der sich am Niveau der NFL orientierte.
Doch diesem hohen Anspruch stand keine ausreichend große finanzielle Basis gegenüber. Viele Teams starteten mit Budgets, die diese Strukturen auf Dauer nicht tragen konnten. Sie arbeiteten von Beginn an defizitär, mussten wiederholt zusätzliche Investoren finden oder privat Geld nachschießen, um den Spielbetrieb überhaupt aufrechtzuerhalten.
Nicht alle Teams waren dazu in der Lage. Die Folge: Standorte verschwanden, wechselten Besitzer oder lösten sich während oder nach der Saison auf. Damit litt nicht nur die sportliche Stabilität, sondern auch das Vertrauen der Fans und Sponsoren – ein Teufelskreis, aus dem die Liga bis heute nur schwer herauskommt.
Zu schnelles Wachstum und eine problematische Franchise-Struktur
Ein weiterer entscheidender Faktor war das überhastete Wachstum der Liga. Bereits im zweiten Jahr expandierte die ELF von 8 auf über 16 Teams – verteilt auf mehrere europäische Länder. Was auf dem Papier nach Erfolg und Expansion klingt, stellte sich in der Realität als Überforderung für Sponsoren, Medien, Personal und Fans heraus. Statt zunächst stabile Identitäten, Rivalitäten und lokale Fanbindungen aufzubauen, wirkte die Liga wie ein ständiges Flickwerk. Teams kamen hinzu, verschwanden wieder oder wechselten ihre Standorte – Kontinuität fehlte.
Hinzu kam, dass die Franchise-Struktur der Liga teilweise chaotisch organisiert war. Während die Liga zentral geführt wurde, waren viele Teams privat betrieben und oft nur knapp finanziert. Das führte zu unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen, Managementfehlern und in einigen Fällen sogar zu Zahlungsrückständen gegenüber Spielern und Trainern.
Manche Franchises agierten professionell und strukturiert, andere erinnerten eher an Semi-Projekte auf Amateurbasis. Diese Ungleichheit innerhalb der Liga schwächte nicht nur die sportliche Fairness, sondern vor allem die Glaubwürdigkeit nach außen. Fans und Spieler merkten schnell, dass Anspruch und Realität nicht durchgehend zusammenpassten – ein Problem, das sich langfristig negativ auf Vertrauen und Stabilität auswirkt.
Genau diesen Fehler will die neu gegründete EFA Liga wiederholen

Weil sie versucht, das gleiche Produkt mit dem gleichen Versprechen, aber ohne die strukturellen Probleme gelöst zu haben, neu aufzubauen. Die EFA (European Football Association oder „neue Liga / Rebrand“) hat das Grundproblem nicht verstanden: Football in Europa braucht Nachhaltigkeit, keine „NFL-Kopie“.
Mit dem Start der neuen EFA (European Football Association) keimt in Europa erneut die Hoffnung auf eine stabile, professionelle American-Football-Liga. Doch ein genauer Blick zeigt, dass die Liga in vielen Punkten die gleichen strukturellen Fehler wiederholt, die bereits die ELF (European League of Football) ins Straucheln gebracht haben.
Zwei neue Teams noch vor dem ersten Snap
Mit der Aufnahme von Teams aus London und Italien holt sich die EFA zweifellos zwei spannende Franchises in die Liga und signalisiert damit ihren Anspruch, wirklich eine Profi-Liga in Europa zu sein. Österreich und Polen werden in der Pressemitteilung nicht mehr erwähnt, während alle anderen Länder weiterhin aufgeführt sind. Es wurden keine Gründe dafür genannt. Doch während die Schlagzeilen von Expansion und Wachstum sprechen, wird ein entscheidender Punkt häufig übersehen: die damit verbundenen Kosten.
London und Italien sind nicht „um die Ecke“. Reisen quer durch Europa bedeuten deutlich höhere Ausgaben für Transport, Unterkunft und Logistik, als viele vermuten. Und genau hier liegt das Problem: Die ELF kämpfte bereits vor Jahren mit denselben finanziellen Herausforderungen.
Die zentrale Frage bleibt: Wie genau hat die EFA dieses grundlegende Finanzproblem so schnell gelöst? Bisher gibt es darauf keine klaren Antworten – und Analysten sehen darin ein potenzielles Risiko, das die Liga schnell wieder einholen könnte.
Die Spieler dürfen nicht die Leidtragenden sein

Schon in der vergangenen Saison gab es deutliche Beschwerden von Spielern über die Reisesituation innerhalb der Liga. Wir reden hier nicht von kurzen Trips oder üblichen Auswärtsfahrten. Wir reden von zwölf Stunden Busfahrt quer durchs Land, Ankunft am Spieltag, Leistung abrufen, danach zwölf Stunden zurück – und am nächsten Morgen steht wieder der Beruf oder das Studium an.
Das ist nicht professionell. Das ist entwürdigend.
Und ja, viele dieser Spieler verdienen nur ein Taschengeld. Das ist bekannt, das ist die Realität einer jungen Liga. Aber man kann nicht erwarten, dass sie ggf. die Reisekosten selbst tragen, oder Reisen antreten, die körperlich und mental völlig unzumutbar sind.
Wenn man sich „Profi-Liga“ nennt – und wenn man Spieler offiziell als „Profis“ vermarktet – dann liegt es in der Verantwortung der Franchises, grundlegende Rahmenbedingungen sicherzustellen:
angemessene An- und Abreise, Hotelzimmer, Verpflegung, Regeneration.
Für Teams wie die Madrid Bravos bringt die geplante internationale Ausrichtung enorme logistische und finanzielle Belastungen mit sich. Sollte Madrid in der kommenden Saison nach London reisen müssen, sprechen wir von einer Strecke von rund 3.456 Kilometern für Hin- und Rückreise. (nach Kopenhagen zu den Nordic Storm, wären es knapp 5.000 Kilometer) Dass man hier nicht mit dem Bus fährt, versteht sich von selbst – eine Fahrtzeit von über 20 Stunden pro Strecke wäre sportlich völlig unzumutbar.
Also bleibt nur das Flugzeug.
Rechnet man bei frühzeitiger Buchung mit etwa 120 Euro pro Person pro Flug, ergibt das rund 240 Euro für Hin- und Rückflug. Für das gesamte Team- und Betreuerpersonal summieren sich die reinen Flugkosten schnell auf über 16.000 Euro. Doch damit ist es nicht getan: Hotelübernachtungen, Verpflegung, Transfers vor Ort und organisatorische Betreuung wiegen deutlich schwerer. Realistisch betrachtet verursacht ein einziges Auswärtsspiel in London Kosten von mehr als 40.000 Euro.
Wenn das Stadion dann nicht ausverkauft ist oder lokale Einnahmen ausbleiben, bleibt für das Team am Ende ein finanzielles Minus, das den Saisonetat erheblich belasten kann.
Sicherlich kann oder muss man als Liga hier einen Blick auf die geografische Lage der einzelnen Franchise haben und legt eben solche in die entsprechende Conference. Doch dann wächst die Gefahr, dass spannende Duelle auf der Strecke bleiben. Im Grunde funktioniert es nur so, dass alle Franschises ausreichend finanzielle Kapazitäten haben, damit es nicht zu Lasten ihrer Spieler geht und das man sorgenfrei planen kann.
Genau hier zeigt sich das Kernproblem internationaler Ligen:
Sportlicher Anspruch und geografische Expansion klingen attraktiv. Doch wirtschaftlich kann jede Auswärtsreise zu einem Risiko werden, das sich nur wenige Franchises langfristig leisten können.
Und genau hier entscheidet sich, ob eine Liga wirklich professionell ist – oder ob sie nur so aussieht.
Wachstum statt Stabilität ist der falsche Ansatz
Auch die EFA setzt augenscheinlich auf Expansion statt auf ein stabiles Fundament. Anstatt zunächst wenige wirtschaftlich stabile Kernstandorte aufzubauen, strebt die Liga wie die ELF früh eine multi-nationale Struktur an. Das hat auch bereits zu einer internen Spaltung in der EFA geführt. Innerhalb der Liga haben sich derzeit zwei Lager herausgebildet, die sehr unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung verfolgen.
Das erste Lager orientiert sich am NFL-Modell: Hier hätten die Franchises die alleinige Entscheidungsgewalt über Liga-Entscheidungen, Regeln, Expansion und Einnahmenverteilung. Vorteil dieser Struktur ist die größere Autonomie für die einzelnen Teams. Nachteilig ist jedoch, dass die finanziellen Risiken stärker bei den Franchises liegen und die Liga insgesamt weniger abgesichert ist.
Das zweite Lager setzt auf die Einbindung eines US-Investors, um die finanziellen Risiken zu verteilen und den Ligabetrieb langfristig abzusichern. Vorteil dieser Strategie ist die größere finanzielle Stabilität, die Investitionen in Infrastruktur, Marketing und Spielerentwicklung ermöglicht. Nachteilig könnte jedoch sein, dass die Franchises ein Stück ihrer Kontrolle und Entscheidungsfreiheit an den Investor abgeben müssten.
Während diese internen Diskussionen andauern, hält die European League of Football an einer Saison 2026 fest. Gleichzeitig gibt es andere paneuropäische Football-Projekte, sodass Europa im kommenden Jahr möglicherweise drei parallel laufende Ligen haben könnte. Dies birgt mehrere Herausforderungen: der Markt könnte fragmentiert werden, Sponsoren, Medien und Fans müssten ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Ligen verteilen. Auch Spieler und Talente könnten sich aufteilen, was die Qualität der einzelnen Ligen beeinflusst. Hinzu kommt, dass die Fankultur darunter leiden könnte, da regionale Rivalitäten und langfristige Bindungen schwerer aufzubauen wären.
Die Liga steht damit an einem entscheidenden Scheidepunkt: Wählt sie das NFL-Modell, behält sie die Kontrolle über die Franchises, riskiert jedoch finanzielle Instabilität. Wählt sie die Investor-Strategie, gewinnt sie Stabilität, könnte aber die Autonomie der Teams schwächen. Die kommenden Monate werden nicht nur die Zukunft der ELF und EFA bestimmen, sondern auch die Entwicklung des gesamten paneuropäischen Football-Ökosystems entscheidend beeinflussen.
EFA 2026: Weniger Teams, größere Chancen
Für die Saison 2026 sollte die European Football Alliance (EFA) eine völlig neue Strategie verfolgen: weniger Franchises, dafür mehr Qualität und Stabilität. Franschises mit einem gesunden Polster an finanzieller Unterstützung aus Sponsoring und Vermarktung. Anstatt schnell mehrere Länder und mit Standorte zu besetzen, die nach der hälfte der Saison wieder ins Straucheln geraten und damit bewusst die Liga auf ein kontrolliertes, nachhaltiges Wachstum setzen. Dadurch kann der Fokus gezielt auf Fanbindung, lokale Rivalitäten und regionale Programme gelegt werden, die langfristige Loyalität erzeugen.
Die geringere Anzahl an Franchises ermöglicht zudem eine solide finanzielle Absicherung: Reisekosten bleiben überschaubar, Sponsor- und Medienerlöse können gezielter eingesetzt werden, und Spieler sowie Staff können zuverlässig bezahlt werden. Auch die Infrastruktur lässt sich so planbar und professionell aufbauen. Gleichzeitig sorgt die Bündelung von Talenten auf weniger Teams für ein höheres Spielniveau, spannendere Partien und eine attraktivere Liga sowohl für Zuschauer als auch für Medien.
Mit kleineren Franchises lassen sich außerdem einheitliche Standards, klare Governance und zentrale Organisationsstrukturen leichter durchsetzen. Die Liga kann sich Schritt für Schritt entwickeln, ohne von Beginn an die Risiken einer überdehnten Expansion tragen zu müssen, wie es bei der ELF der Fall war.
Das erwartete Ergebnis dieses Ansatzes ist eine nachhaltige Fanbasis, die sich stärker mit professionell organisierten, lokal verankerten Teams identifiziert. Gleichzeitig wird die finanzielle Stabilität erhöht, da das Risiko von Zahlungsproblemen oder Insolvenzen reduziert wird. Langfristig kann die EFA so eine solide, professionelle Liga aufbauen, die Bestand hat und in Europa echte Football-Kultur etabliert.
Fazit:
Leider ist es so, dass die EFA derzeit ähnlich intransparent agiert, wie es viele bereits aus der späteren Phase der ELF kannten. Offizielle Informationen sind rar. Es existiert keine funktionierende Website, keine zentrale Informationsplattform, nur ein Instagram-Account – und selbst dort lassen sich die Beiträge sprichwörtlich an zwei Händen abzählen. Die Fans stehen im Dunkeln und sind mittlerweile mehr als nur genervt und einige halten sogar eine Saison im nächsten Jahr für unwahrscheinlich.
Für eine Liga, die professionellen Anspruch erhebt und internationale Aufmerksamkeit generieren möchte, ist das ein Problem. Ohne klare Kommunikation, ohne öffentlich nachvollziehbare Strukturen und ohne verlässliche Informationskanäle entsteht der Eindruck, dass noch nicht einmal die Grundlagen stehen.
In einer Phase, in der Vertrauen aufgebaut werden müsste, bleibt stattdessen ein Fragezeichen.
Zum Abschluss bleibt der Wunsch, dass Europa eine langfristig stabile und glaubwürdige American Football-Liga erhält – unabhängig davon, welchen Namen sie trägt. Vielleicht bedeutet das, an einigen Stellen kleinere Schritte zu gehen, Ambitionen realistisch auszurichten und zunächst solide Grundlagen zu schaffen, bevor man nach ganz oben angreift. Doch genau solche Abstriche können am Ende die Voraussetzung dafür sein, dass etwas Beständiges entsteht.
Wenn die Liga-Verantwortlichen, Spieler und Fans gemeinsam an einem Strang ziehen, kann europäischer Football mehr sein als ein kurzfristiges Projekt werden. Es kann zu einer echten, lebendigen Sportkultur werden, die nicht nur Events produziert, sondern Identität, Tradition und nachhaltige Begeisterung schafft.
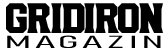
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Antwort abbrechen
Leave a Reply
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.











Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.